
| Economics Digest | Impressum & Datenschutz |

| Der Frust mit der Bürokratie
In der EU, insbesondere in Deutschland, wird überbordende Bürokratie beklagt.
Dabei geht es nicht nur um den hohen bürokratischen Aufwand, sondern auch um Überregulierung, Intransparenz und ineffiziente Abläufe.
Viele Branchen leiden unter übermäßigen Dokumentationspflichten, z.B. im Gesundheitswesen, Bauwesen und Landwirtschaft. Durch die Dokumentationspflichten geht ein großer Teil der Arbeitszeit mit dem zusätzlichen Ausfüllen von Formularen drauf, worauf niemand Lust hat. Anforderungen, die einem überflüssig zu sein scheinen, werden als Gängelung empfunden und schüren auch Wut auf den Staat. Für den Betroffenen ist es auf jeden Fall eine Zeit- und Ressourcenverschwendung, zudem lenkt es den Fokus von der eigentlichen Arbeit ab. Die Produktivität sinkt.
Auf Ämtern gibt es lange Bearbeitungszeiten, z.B. bei Bauanträgen, Visa, Elterngeld, Wohngeld etc.
Die Folgen sind Verzögerungen bei Projekten, Frustration bei Bürgern und Unternehmen - und auch in den Ämtern!
Die Regelungsdichte steigt und es gibt kleinteilige Vorschriften bei Bauvorhaben, Umweltauflagen oder Sicherheitsvorgaben. Das Steuerrecht ist lange bekannt für seine zahllosen Ausnahmen. Desweiteren gibt es widersprüchliche Zuständigkeiten und komplizierte Antragsverfahren. Deshalb benötigen Bürger und Betriebe oft externe Hilfe, um Vorgaben überhaupt zu verstehen, korrekt zu beantragen und richtig umzusetzen. Und durch den Rückstand in der Digitalisierung in Deutschland, müssen viele Behördengänge immer noch persönlich und mit Papierformularen erledigt werden, obwohl digitale Lösungen technisch möglich wären, die in anderen Ländern schon seit Jahren umgesetzt und verfügbar sind. |
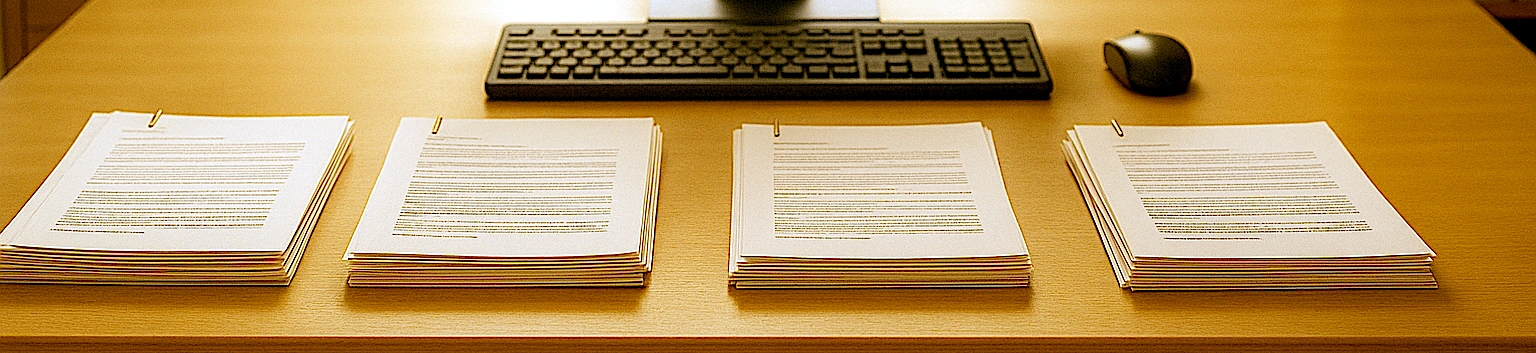
| Enttäuschende Entlastungsgesetze
In Deutschland gibt es bereits vier Bürokratie-Entlastungsgesetze (2016, 2017, 2020, 2024). Trotzdem scheint es keine spürbare Entlastung zu geben.
Ganz im Gegenteil: In den letzten Jahren wurde eine Zunahme der Belastung beklagt.
Das erste Bürokratieentlastungsgesetz (BEG I) trat 2016 in Kraft. Es hatte den Bürokratieabbau insbesondere für kleine Unternehmen als Ziel. Dies betraf im Wesentlichen die Buchführungspflicht: Die Schwellenwerte für Umsatz und Gewinn wurden angehoben. Normalgroße Unternehmen haben davon jedoch nichts, nichtmal z.B. Ein-Personen-GmbHs profitieren davon. Das zweite Entlastungsgesetz (BEG II) trat 2017 in Kraft. Hierbei ging es wieder um kleine und mittlere Unternehmen (KMU).
Z.B. wurde die Kleinbetragsgrenze für Rechnungen angehoben. Das hat aber in der Realität keine Auswirkung,
denn für andere Rechnungen müssen die Pflichtangaben sowieso gemacht werden.
Das vierte Entlastungsgesetz (BEG IV) trat 2024 in Kraft.
In über 25 Fällen werden Schriftform-Erfordernisse abgebaut.
Die Aufbewahrungsfristen für steuerliche Belege werden von zehn auf acht Jahre verkürzt.
Letzteres bringt jedoch keine Arbeitsentlastung, denn die Belege sind ja bereits erstellt und bereits archiviert,
bzw. sind weiterhin zu erstellen und zu archivieren.
Insbesondere vom Mittelstand werden die versprochenen "Entlastungen" als Enttäuschung wahrgenommen. Unternehmen berichten, dass die von der Politik groß angekündigten Erleichterungen „in der Praxis kaum spürbar“ sind. Die Entlastungen betreffen häufig nur kleinere Detailregelungen, aber nicht die grundlegenden bürokratischen Probleme wie die vielen Berichtspflichten, unübersichtliche Meldepflichten oder die komplexe Steuer- und Sozialgesetzgebung. Es fehlt an einer ganzheitlichen Modernisierung staatlicher Prozesse, dabei auch die Digitalisierung. Während Entlastungen angekündigt wurden, wurden gleichzeitig neue Pflichten eingeführt, z.B. die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO 2018), das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG 2023), das Plattformen-Steuertransparenzgesetz (PStTG 2023), EU-Berichtspflichten wie CSRD (2024), diverse ESG-Vorgaben (2014 bis 2023), das NIS2-Umsetzungsgesetz 2025 und CSDDD ab 2027. Unternehmen empfinden die angebliche "Entlastung" als zynisch. |

| Bürokratie-Abbau vorläufig gescheitert
Von 430 Vorschlägen aus der Wirtschaft zum Bürokratieabbau wurden nur 11 in das vierte Entlastungsgesetz aufgenommen.
Der Staat steht vor dem Dilemma zwischen dem dringenden Wunsch nach weniger Bürokratie und dem gleichzeitigem gesellschaftlichen und politischen Druck für
eine gerechtere Verteilung, mehr Verbraucherschutz, Umweltschutz und Nachhaltigkeit, Datenschutz, Arbeitnehmerschutz und anderen Themen.
Durch den Wunsch nach Gerechtigkeit ohne Schlupflöcher steigt nicht nur die Menge, sondern auch die Komplexität der Regulierung.
Der Justizminister sieht das Problem aber auch im Vollzug: „Viele Bürger und Betriebe nervt ja nicht nur, was im Gesetz steht, sondern auch die Art und Weise, wie die Gesetze von den Behörden vollzogen werden.“ Selbst wenn bestehende Gesetze nachträglich vereinfacht werden, kann die praktische Umsetzung in den Behörden weiterhin kompliziert bleiben. Außen kommt die Vereinfachung nicht an. Besteht Hoffnung auf einen effektiven Bürokratieabbau? Ja vielleicht. Eine große Hürde ist, dass Bürokratieabbau nicht zum Abbau berechtigter Schutzinteressen führen soll, denn die sind eine Grundlage für demokratische Rechtsstaatlichkeit. Im Allgemeinen dienen Regelungen dem Schutz von Allgemeinwohl, Grundrechten und öffentlichen Gütern. Wenn sinnvolle Regeln im Zuge eines Bürokratieabbaus verwässert werden, kann dies für die ganze Gesellschaft gravierende negative Folgen haben. Beispiele aus der Vergangenheit zeigen, dass Skandale und Katastrophen oft dort entstanden, wo staatliche Kontrollen versagt oder gefehlt haben. Ein effektiver Bürokratieabbau sollte also nicht pauschal irgendwelche Vorschriften abschaffen, sondern gezielt überflüssige, widersprüchliche oder veraltete Regelungen identifizieren, Prozesse vereinfachen, digitalisieren und beschleunigen - möglichst ohne dabei die Schutzstandards zu senken.
Seitdem das Internet endlich kein Neuland mehr ist, liegt die große Hoffnung in der Digitalisierung.
Inzwischen sind die Vorteile sogar in den Köpfen alter Leute und Politiker angekommen.
Bürger, Unternehmen und Verwaltungen fordern zunehmend praktikable, digitale Lösungen.
Und so sind Bürokratieabbau und Digitalisierung inzwischen zu einem breiten politischen Konsens geworden - über alle Parteigrenzen hinweg.
Digitale Verwaltungsprozesse können viele bürokratische Lasten abbauen, ohne dabei gute Standards zu verlieren. Beispiele sind: Online-Anträge (bitte maximal benutzerfreundlich umgesetzt), einheitliche Plattformen und das "Once Only"-Prinzip, d.h. Daten müssen nur einmal angegeben werden. Außerdem braucht es schnelle, digitale Abläufe innerhalb der Verwaltung. Aber Digitalisierung ist kein Allheilmittel: Wenn man einen verkorksten Prozess digitalisiert, hat man einen digitalen verkorksten Prozess. Es geht also oft nicht nur um die Digitalisierung und um weniger Regeln, sondern um bessere Regeln und bessere Abläufe, z.B. die Standardisierung von Formularen bundesweit oder sogar EU-weit, der Wegfall von Doppelmeldungen an verschiedene Behörden, verständliche Erläuterungen und das Klarstellen unklarer Rechtsbegriffe. Also bitte Einfachheit, Rechtsklarheit und Praxistauglichkeit anstelle voreiliger Deregulierung - und das Ganze dann in Kombination mit benutzerfreundlicher Digitalisierung. Das ist die nächste große Aufgabe, wofür es eines gemeinsamen politischen Willens bedarf. |